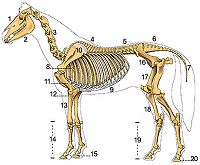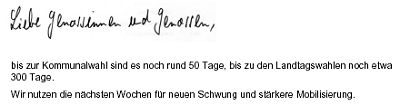|
Der Spiegel 32/2004, 2. 8. 04 |
"Wir brauchen eine neue Ideologie"
Die Kanzler-Freunde Günter Grass, Peter Glotz und Markus Lüpertz
über den Niedergang der deutschen Sozialdemokratie, die Fehler der
Wiedervereinigung, Illusionen des Sozialstaats und die Frage, was
eine Nation zusammenhält
 |
|
DPA
Kanzler Schröder, Mitarbeiter: "Die Agenda
2010 hätte 1999 stattfinden können"
|
SPIEGEL: Herr Grass, Sie waren auf dem 60. Geburtstag von
Gerhard Schröder zu Gast und hinterließen ihm in einer privaten
Zueignung das Versprechen: "Ich aber höre nicht auf zu quengeln." Was
genau stört Sie an Ihrer SPD?
Grass: Es ist die alte Krankheit, dass Sozialdemokraten
Hemmung haben, zu ihren Leistungen zu stehen. Sie bringen etwas in
Gang, bewegen etwas, und wie das in einer demokratischen Gesellschaft
nicht anders sein kann, ist das, was sie bewegen, von Kompromissen
belastet. Und dann sagen sie: Wir hätten es eigentlich noch besser
machen können, aber es ist uns diesmal nicht gelungen. Punkt zwei ist
die Kommunikation mit den Menschen, die zum Teil in ein unglaubliches
sprachliches Kauderwelsch absinkt. Ein Mann wie Hans Eichel, der sich
anfangs als Finanzminister dadurch auszeichnete, dass er komplizierte
Sachverhalte klar darstellen konnte, ist offenbar derart in Beweisnot
geraten, dass er nicht mehr in der Lage ist, reale Zwänge so
auszusprechen, dass sie begriffen werden. Aber nur das, was die
Menschen begreifen, können sie auch akzeptieren.
SPIEGEL: Herr Glotz, Sie waren vielen SPD-Vorsitzenden,
-Kanzlern und -Kanzlerkandidaten zu Diensten. Sie haben Ihre Partei
stets vor einem machtfernen Romantizismus gewarnt, Kampagnenfähigkeit
nicht nur eingefordert, sondern auch organisiert. Was, glauben Sie,
fehlt der Sozialdemokratie heute?
Glotz: Die SPD steckt in einer Falle. Die Falle besteht
erstens in der Tatsache - die geht auf das Konto von Helmut Kohl -,
dass 16
Jahre lang die Finanzierung der Sozialsysteme nicht
angepackt wurde. Sie besteht zweitens in dem, was Günter Grass
seinerzeit immer wieder beklagt hat: in einer ökonomisch völlig
fehlgeleiteten Wiedervereinigung, die der Bundesregierung jetzt jede
Investitionskraft nimmt. Dann hat sie noch diesen Brüsseler
Stabilitätspakt, und in diesem Rahmen kann sie sich sehr schwer
bewegen.
"Die Art, wie alles, was in der DDR geschaffen worden ist, abgetan
wurde, ist beschämend". GÜNTER GRASS
SPIEGEL: Schröder, Müntefering, alle Getriebene des
Langzeitkanzlers Kohl?
Glotz: Nicht allein: Ich werfe meiner Partei vor, dass sie
sich von einer Partei der Aufklärung zu einer Partei der
Sozialpolitik hat machen lassen. Denn dass die großen Themen der
kämpferischen Sozialdemokratie sozusagen in kleiner Münze der
Praxisgebühr ausgezahlt werden, liegt auch an der SPD selbst - und
man muss hinzufügen, dass sie bis 1998 in der Opposition die Parolen
ausgegeben hat, die jetzt ihre Gegner, zum Beispiel der sagenhafte
Kollege Bsirske von Ver.di, gegen sie wenden. Ich registriere
Verzagtheit und Kleinmut überall im Lande, auch in der SPD.
SPIEGEL: Herr Lüpertz, die Kunst sollte die Menschen aus
Lustlosigkeit, Lethargie und Todesangst befreien, haben Sie einmal
gesagt. Der neue Bundespräsident versucht genau das: Zuversicht
einzuflößen, ohne die Zumutungen, die da kommen werden, zu
verschweigen. Der richtige Weg?
Lüpertz: Nichts gegen den Mann; er ist sicherlich integer.
Aber es ist doch erstaunlich, dass dieser Mann vom Geld kommt.
Glotz: Ökonomische Kompetenz spricht ja nicht gegen einen
Mann. Warten wir doch erst mal ab!
Lüpertz: Das ist nicht der Punkt. Ich meine das als Signal,
als Zeichen. Vielleicht wäre es viel besser zum Beispiel, Günter
Grass würde Bundespräsident werden. Er ist Nobelpreisträger, er steht
international für Intellektualität und vieles mehr. Aber es wird ein
Mann genommen, der aus dem Geld kommt. Offenbar gibt es nur noch ein
Kriterium, und das ist Cash. Mir ist das zu wenig in dieser
historischen Situation, in der das Land sich befindet.
SPIEGEL: Wie würden Sie diese Umbruchsituation
charakterisieren?
Lüpertz: Deutschland ist mit der Einheit unregierbar geworden.
Ich bin eigentlich Bundesrepublikaner ...
Glotz: ... Sie meinen, Sie sind ein Bonner Republikaner.
Lüpertz: Nennen Sie es, wie Sie wollen. Alle wissen, was ich
meine. Diese Bundesrepublik hat eine für meine Begriffe gigantische
und große Arbeit geleistet. Bis zur Wiedervereinigung hat sie eine
eigenständige Form von neuem Deutschland aus den Trümmern geboren.
Diese Bundesrepublik hatte eine ganz bestimmte Qualität, weil sie in
sich selbst unverbraucht war. Sie war, überspitzt formuliert,
regierbar.
SPIEGEL: Und nach der Wiedervereinigung?
Lüpertz: Die Bundesrepublik ist abgestorben, und ich habe das
Gefühl, dass Deutschland jetzt auf Grund dieses Zusammenschlusses
nicht mehr regierbar ist. Denn es gibt keine nationale Identität, es
gibt kein Selbstverständnis, sich in irgendeiner Weise deutsch zu
fühlen.
Glotz: Regierbar sind wir doch nicht deswegen kaum noch
richtig, sondern weil uns die Globalisierung das Leben schwer macht,
weil die Arbeitsplätze zum Beispiel nach Polen verlagert werden.
Lüpertz: Alles kann man mit einem Volk machen. Man kann es
auch zum Sparen anhalten. Man kann ihm klar machen, dass jetzt
weniger da ist und dass weniger verteilt wird, wenn es an sich selbst
glaubt. Ist das nicht der Fall - und das erleben wir zurzeit -, haben
wir einen reinen Egoismus, der sich in Geld ausdrückt.
SPIEGEL: Das fehlende Geld und die deutsche Einheit -
Schlüsselbegriffe bei der Ursachenforschung für die deutsche Misere?
 |
|
DDP
Günter Grass
|
Grass: Wir müssen nur zurückgehen zu dem entscheidenden
Datum: 1989/90. Da meinte man auch schon, alles übers Geld machen zu
können. Die Verfassungsväter hatten der alten Bundesrepublik
aufgegeben, dass im Fall der Wiedervereinigung dem deutschen Volk
eine neue Verfassung vorgelegt werden müsse, was im Grunde eine
Neugründung des Staates bedeutet hätte, aber das hat man vermieden.
Man hat die Einheit über den Beitrittsartikel vollzogen, und das
rächt sich nun.
Glotz: Das hat man leider überparteilich falsch gesehen. Die
Sozialdemokraten haben
mitgemacht. Das ist ein gemeinsamer Fehler der
beiden Volksparteien.
Grass: Wir haben die Erfahrung, dass 40 Jahre lang zwei
deutsche Staaten nebeneinander existierten. Nicht nur wir im Westen
haben aufgebaut; auch der Osten hat unter beschränkten Möglichkeiten
aufgebaut. Die Missachtung der östlichen Leistung - bleiben wir mal
in unserem Kunstbereich -, die Art und Weise, wie alles, was in der
DDR trotz Diktat und Zensur geschaffen worden ist, abgetan wurde, das
war beschämend. Grässliche Verdikte wurden verhängt. Wir sind nicht
in der Lage gewesen, diese Leistung anzuerkennen.
SPIEGEL: Und das wirkt bis heute?
Grass: Es steht dem im Wege, was Herr Lüpertz eingeklagt hat,
dass man nicht zusammenkommt, dass in manchen Bereichen, weil dann
auf ostdeutscher Seite die Enttäuschung einsetzt, die Trennung heute
gravierender ist als zur Zeit der Mauer.
Lüpertz: Präzise.
Grass: Das ist ein klägliches Ergebnis.
SPIEGEL: Lässt sich das nachholen? Die Dohnanyi-Kommission
denkt ja heute kritischer über den Aufbau Ost. Viele, die Sie, Herr
Grass, damals kritisiert haben ...
Grass: ... schweigen heute, ja ...
SPIEGEL: ... kommen heute zu der Erkenntnis, dass Ihre Kritik
so ganz falsch nicht war, dass man vielleicht langsamer schneller
vorangekommen wäre.
Grass: Ich habe mit Ihrem großen Vorsitzenden im SPIEGEL,
Rudolf Augstein, ja darüber mal eine Auseinandersetzung gehabt. Er
hat mir auf jedes Argument gesagt: Der Zug ist abgefahren. Wie ein
Bahnhofsvorsteher hat er reagiert.
Glotz: Es gab viele Bahnhofsvorsteher damals.
Grass: Es gab keine Bereitschaft mehr hinzuhören. Im
Gegenteil: Man wurde als vaterlandsloser Geselle und als Feind der
Einheit diffamiert.
SPIEGEL: Der große Vorsitzende kann uns womöglich zuhören,
aber sich nicht einmischen. Also lassen wir das. Lässt sich heute
noch etwas korrigieren?
Grass: Aber natürlich. Wir müssen alles nachholen, was wir
1990 versäumt haben. Wir brauchen eine neue Verfassungsdebatte, in
der auch die Ostdeutschen zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit
haben, soweit das noch möglich ist, ihre Erfahrungen während 40
Jahren Diktatur und auch 40 Jahren Eigenleistung einzubringen.
Glotz: Sie haben vorhin das Stichwort "Zumutungen" genannt.
Darauf hat Markus Lüpertz gesagt: Weil dieses Land keine Identität
hat, geht es nur noch um Geld, und deswegen sind die Zumutungen so
schwierig. Ich glaube, da ist etwas dran, und dennoch würde ich gern
weiter zurückgehen: Wir haben natürlich alle eine ganze Zeit lang
geglaubt, dass diese Wachstumsperiode von 1950 bis 1975 ökonomisch
weitergehen würde. Das ist der Urfehler, den wir gemacht haben. Ich
kritisiere nicht die Adenauer-Zeit. Da hatten wir ein Wachstum, mit
dem man die Sozialpolitik machen konnte, die Adenauer betrieben hat,
auch Brandt noch.
SPIEGEL: Helmut Schmidt war der erste Kanzler, der die
Globalisierung sah, der ein Umsteuern versucht hat.
Glotz: Schmidt hat es ja begriffen, dass eine neue Zeit
begonnen hat, aber meine Partei ist Schmidt nicht gefolgt, ist
Schiller nicht gefolgt. Denken Sie an die drei ökonomisch wirklich
kundigen Sozialdemokraten, die wir hatten: Das waren Karl Schiller,
Helmut Schmidt und Alex Möller. Schiller und Möller sind
zurückgetreten. Schmidt - ich werde es nie vergessen - hat unseren
Leuten in der Fraktion gesagt, man müsse noch viel tiefer in das
soziale Netz schneiden: "Das ist mit euch nicht zu machen. Deswegen
muss ich zurücktreten." Das war 1982. Der Mann hatte Recht.
SPIEGEL: Schröder macht da weiter, wo Schmidt aufgehört hat.
Sozialabbau, rufen die heimatlosen Linken. Die Reformen sind
unverzichtbar, erwidert ein zunehmend stoischer Kanzler. Wer hat
Recht?
"Ich registriere Verzagtheit und Kleinmut überall im Lande, auch
in der SPD". PETER GLOTZ
Grass: Wir sind für unseren gezähmten Kapitalismus bewundert
worden. Es ist sinnlos und wäre auch falsch zu sagen, wir müssten
jetzt das soziale Netz zerschlagen. Dafür gibt es ja Anstrengungen
genug. Nein, nach wie vor wird die soziale Sicherung der Menschen,
die ein Arbeitsleben
hinter sich haben, und der jungen Menschen, die noch
gar nicht eingestiegen sind, im Vordergrund stehen.
Da liegt sicher auch ein Fehler dieser Regierung, dass sie nicht
während der ersten Legislaturperiode an die Großverdienenden, an die
Besserverdienenden herangegangen ist. Natürlich wäre eine höhere
Erbschaftsteuer richtig.
Glotz: Ich fürchte, man ist auf dem falschen Trip, wenn
zumindest ein Teil der SPD - nicht Schröder, aber der linke Flügel -
nun glaubt, das Problem könne man dadurch lösen: höhere
Erbschaftsteuer, höhere Vermögensteuer, Ausbildungsabgabe. Das sind
alles Instrumente, die nicht funktionieren werden. Leider sind die
Steuerberater immer informierter und geschickter als die
sozialdemokratischen Programmatiker und die Finanzbeamten.
SPIEGEL: Was eine Vielzahl Ihrer Genossen nicht davon abhält,
es immer aufs Neue zu versuchen.
Glotz: Wir wiederholen einen Prozess, den wir in den siebziger
Jahren - ich war damals Staatssekretär im Bildungsministerium - schon
mal versucht haben. Es ist die Grundidee, die mich stört: Wir müssen
jetzt leider unserer eigenen Klientel Zumutungen bieten. Wenn wir das
tun, dann sollen gefälligst auch die Reichen, die Besserverdienenden
- ich kann das Wort schon nicht mehr hören - bluten. Das ist ein zu
primitives Modell.
SPIEGEL: Sie waren einst einer der glühendsten
Lafontaine-Anhänger.
Glotz: Ich bin nach wie vor ein guter Freund von Oskar
Lafontaine und halte ihn für menschlich zuverlässig. Die archaische
Wirtschaftspolitik, die er in seinen heutigen Zeitungskolumnen
fordert, halte ich allerdings nicht für richtig.
SPIEGEL: Was bedeutet dann heute links? Oder ist das eine
Terminologie, die auch für Sie, der Sie in der Geschichte der SPD
tief verankert sind, keine Bedeutung mehr besitzt?
Glotz: Ich kann links und rechts durchaus voneinander
unterscheiden. Jeder, der das nicht mehr kann, hat offenbar den
Gleichgewichtssinn verloren. Aber wenn man als links einfach
definiert, jetzt kassieren wir mal die Leistungsträger ab, dann ist
das ein Missverständnis des Kapitalismus. Da kann man gleich sagen:
Wir schaffen den Kapitalismus ab. Das ist bisher aber nicht besonders
gut geglückt.
SPIEGEL: Herr Grass, was ist links?
Grass: Im Fall einer Krisensituation, wie wir sie nach den
Terroranschlägen in Amerika gehabt haben, war die linke Reaktion von
Schröder, in diesen Krieg, in dieses Abenteuer nicht einzusteigen.
Ganz gewiss wird auf Dauer historisch herausragen, dass es dem
Kanzler und seinem Außenminister gelungen ist, zum ersten Mal von
unserer seit 1990 existierenden Souveränität wirklich Gebrauch zu
machen, indem sie mit sehr viel Mut und Standfestigkeit uns Deutsche
aus diesem furchtbaren Krieg im Irak herausgehalten haben. Und ich
muss auch sagen: Wie der Innenminister es verstanden hat, dieses Land
frei von Hysterie zu halten, das ist auch eine linke Politik, die
viele anerkennen.
SPIEGEL: Und in der Wirtschafts- und Sozialpolitik bedeutet
"links sein" ...
Grass: ... dass man sich Alternativen zu dem überlegt, was es
an Ungleichheit nicht nur im eigenen Land gibt. Es geht auch um die
skandalöse Diskrepanz zwischen Leuten, die aus unserem Sozialsystem
mittlerweile ausgesteuert sind, und den horrenden Summen, die sich
die Chefs in den Banken und im Großmanagement zugestehen. Das ist in
einer Demokratie nicht mehr zu verantworten. Wenn man in dieser Sache
Partei ergreift, ist das eine linke Position.
SPIEGEL: Links war auch immer der Ruf nach mehr Staat, dem
Umverteilungsstaat, dem Steuerstaat, dem Staat der
Investitionsprogramme. Und heute?
Lüpertz: Ich bin gegen die Allmacht des Staates. Ich bin ein
Kind der von mir so geliebten Bundesrepublik, ein Nierentischkind.
Ich habe in den fünfziger Jahren den Staat nicht kennen gelernt.
Politik war etwas Fremdes. Die Polizei tauchte mal auf; dann war das
schon eine Katastrophe. In der Familie, im Alltag spielten Politik,
Politiker, Zurechtweisungen von der Politik, Verbote - das
Anschnallen im Auto, kein Handy beim Autofahren - keine Rolle. Das
Thema hat sich verschärft: Der Staat wird immer selbstverständlicher.
Die Familien haben ihre Versorgung an den Staat abgegeben. Die
Wirtschaft gibt die Versorgung der Arbeitslosen an den Staat ab. Es
gibt eine Art von Selbstverantwortung, die meiner Meinung nach nicht
wahrgenommen wird.
Glotz: Aber was folgt aus Ihrer Sehnsucht nach den fünfziger
Jahren?
Lüpertz: Es gibt kein Zurück. Ich finde, es sind andere
Ideologien denkbar als immer nur der staatliche Zugriff. Es muss doch
möglich sein, dass sich die Gesellschaft in bestimmten Dingen selbst
organisiert. Es kann doch nicht sein, dass der Staat permanent die
Familie, das Land, die Wirtschaft reglementiert.
Glotz: Also, Sie wollen mehr Selbstverantwortung?
Lüpertz: Und mehr Risiko. Ich glaube, dass der Staat für die
Lösung vieler Aufgaben ungeeignet ist, weil er sich zu sehr auf das
Spiel von Geld, von Reich und Arm, den Reichen nehmen, den Armen
geben, einlassen muss und sich ständig Dinge einfallen lässt, um die
Belastungen zu erhöhen. Wenn man 56 Prozent Steuern zahlt, dann ist
das Wucher. Es ist bis jetzt noch keinem etwas anderes eingefallen,
als immer nur etwas zu erhöhen und zu verschärfen. Es geht ja nicht
darum, dass man nicht bereit ist, etwas zu bezahlen. Man ist ja
bereit, permanent zu zahlen. Es geht einfach darum, dass Erfolg
mittlerweile eine Art von Fluch geworden ist.
SPIEGEL: Mit Verlaub: Das ist nicht gerade eine
sozialdemokratische Position, die Sie da vertreten.
Lüpertz: Ich bin kein Sozialdemokrat.
Glotz: Er ist ein Freund von Schröder.
Lüpertz: Das ist etwas ganz anderes.
Grass: Es ist die neoliberale Position. Die ist sattsam
bekannt. Die ist, wie ich finde, auf eine deprimierende Art und Weise
auch erfolgreich, nämlich mit dem Ergebnis, dass wir in vielen
Bereichen zu wenig Staat haben. Ich widerspreche Ihnen diametral. Der
Einfluss der Lobby, der Interessenverbände,
ist nie so stark gewesen wie in unserer Zeit. Sie
bekommen zum Beispiel im Bereich Gesundheitsreform das Gesetz nicht
durch, wenn es nicht vorher von der Pharmaindustrie, von den
Apothekerverbänden, von den Ärzteverbänden und von den Kassen
abgenickt wird. Eine Eindämmung der Lobby, eine Art Bannmeile
bräuchte man. Ich behaupte: Der Einfluss des Staates ist zu gering.
Glotz: Ich oute mich jetzt mal als
Karl-Schiller-Sozialdemokrat. Wir sind in der Tat in einer Situation,
in der wir nicht mehr ein Proletariat haben, für das wir so vorsorgen
müssen, wie wir für das Proletariat vorsorgen mussten im späten 19.
Jahrhundert oder auch noch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts. Der
Hinweis von Günter Grass, dass es noch Armut gibt, auch neue Armut,
halte ich für absolut richtig.
Grass: Wachsende Armut!
Glotz: Auf der anderen Seite sage ich: Der Satz "Wir müssen
uns nicht um die Besserverdienenden sorgen" ist falsch. Wenn wir die
Motivation dieser fünf Prozent von Wissensarbeitern, die den
Kapitalismus am Laufen halten, zerstören, wird das Wachstum so
absinken, dass wir Machtkämpfe bekommen, Verteilungskämpfe, die so
brutal sind, wie wir sie uns gar nicht mehr vorstellen können.
Lüpertz: Die gehen weg, die kämpfen nicht.
SPIEGEL: Welche Rolle könnten und sollten heute Begriffe wie
Eigenvorsorge und Selbstverantwortung spielen?
Grass: Wir haben immer weniger Jugendliche, wobei diese
Jugendlichen dennoch keinen Ausbildungsplatz finden. Es gibt die
älteren Menschen, die zum Teil durch Arbeitslosigkeit, durch
Langzeitarbeitslosigkeit aus dem herausgeworfen werden, was das
Bruttosozialprodukt ergibt. Sie befinden sich mehr und mehr außerhalb
der Gesellschaft. Wir müssen aufpassen, dass für Großverdiener das
Ausmaß des Mitleids nicht ungeheure, fast religiöse Dimensionen
annimmt.
"Wenn das Gemeingefühl nicht mehr trägt, sind den Politikern die
Hände gebunden". MARKUS LÜPERTZ
Lüpertz: In anderen Systemen, zu anderen Zeiten haben immer
Leute in der Scheiße gesessen. Das gibt es nun mal in irgendeiner
Form. Daran arbeiten ja die Sozialdemokratie und viele andere
Parteien auch, damit das eben besser wird. Es geht doch jetzt darum:
Was passiert mit Deutschland? Was passiert mit jener Gruppe, die die
Bundesrepublik immer ausgezeichnet hat, dem Mittelstand? Nur ein
Bruchteil der Leute ist in der Hochfinanz, in diesem ganzen Manager-
und Lobbyistenbereich beschäftigt. Die meisten Menschen arbeiten in
Betrieben, in Geschäften, in Arztpraxen, sind Anstreicher oder
Metzger. Diese Schicht ist im Moment bedroht, dort sind die meisten
Pleiten, die meisten Arbeitslosen. Das ist das Gespenstische, dass
dieser Kraftmuskel des Landes erschlafft.
SPIEGEL: Hieß diese Bevölkerungsschicht nicht bis vor kurzem
neue Mitte?
Grass: Dem Mittelstand muss man auf jeden Fall helfen, keine
Frage. Das ist allerdings nicht nur eine Frage des Staates. Die
großen Schwierigkeiten liegen auch im Umgang mit den Banken. Man muss
sich einmal vorstellen, dass es in Ostdeutschland eine Vielzahl von
kleinen Handwerkern gegeben hat, die sich über die 40 Jahre
DDR-Herrschaft gerettet haben. Dann kam die Vereinigung, und sie
bekamen keine Kredite bei den Banken.
SPIEGEL: Der unternehmerische Mittelstand und die
soziologische Mitte der Gesellschaft wenden sich zu großen Teilen ab
von der Volkspartei SPD. Warum? Zu viele Reformen oder zu wenige?
Lüpertz: Die Probleme reichen weit über die SPD hinaus. Ich
glaube, wenn man keine Ideologie hat, die einen bindet, dann ist es
schwierig, ein 80-Millionen-Volk, einen 80-Millionen-Moloch in eine
ganz bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn Sie immer diese
Feindschaften aufbauen - der Staat, die da oben, immer nur dieses
"das nutzt mir nichts" -, wenn das Gemeingefühl nicht mehr trägt,
dann sind Ihnen als Politiker die Hände gebunden. Wir brauchen eine
Ideologie.
Grass: Wer will denn eine haben?
Lüpertz: Sie brauchen als Nation eine Ideologie, um sich zu
verständigen.
Glotz: Er meint eine tragende Idee, ein Konzept.
Lüpertz: Ideologie und Identität - wollen Sie das trennen?
Dann haben Sie keine Sprache mehr. Wenn Sie kein Ideal davon haben,
was Sie wollen, dann können Sie auch nichts mehr vermitteln. Dann
können Sie nur noch Ihren kleinen, individuellen Kosmos befriedigen.
Glotz: Was Herr Lüpertz meint, ist: Ein Staat wird nicht
zusammengehalten durch ein vernünftiges System von Gütern und
Dienstleistungen, sondern du brauchst irgendein Mehr.
Lüpertz: Du brauchst eine Identität, du brauchst eine Sprache,
eine Einheit, irgendetwas außerhalb des Normalen.
Grass: Besinnen wir uns doch auf das, was bei uns tragfähig
war und weiterhin sein könnte. Das ist erst einmal das, was uns
geschenkt worden ist - wir haben es uns ja gar nicht so sehr
erkämpft: die Demokratie. Wir haben sie weiterentwickelt. Wir haben
das Glück gehabt, dass es zur Einheit gekommen ist - nicht zur
Einigung, zur Einheit einigermaßen. Die Kraft zur Erneuerung können
wir nicht aus einer Ideologie gewinnen, sondern nur aus einer
gelebten Demokratie.
Lüpertz: Aber was nutzt die Demokratie, wenn
sie nicht begriffen ist? Wenn sie nicht benutzt wird?
Grass: Wir tun so, als wäre die Bundesrepublik am Ende. Wir
können uns in vielen Bereichen, selbst im Bereich der Forschung,
sehen lassen. Es ist nicht so, dass wir in allen diesen Bereichen
Schlusslicht sind, wie es dauernd behauptet wird. Das ist absolut
nicht der Fall.
Lüpertz: In der Kultur sind wir führend.
Grass: Mein Gott, welch ein Reichtum in einem Land mit dieser
kulturellen Vielgestalt! Fahren Sie nach Frankreich, da ist es nach
wie vor nicht gelungen, den Wasserkopf Paris zu entlasten. Außerhalb
ist alles Provinz. Ich bin gegen die Überbetonung der Hauptstadt
Berlin. Wir haben - eine ironische Frucht des Dreißigjährigen Krieges
- durch die Aufteilung Deutschlands in Kleinstaaten überall noch
bespielbare Residenztheater, Museen und anderes, eine kulturelle
Substanz. Die Frage ist, ob wir nicht bei unserem dauernden Gezänk
dabei sind, auch das noch kaputt- und kleinzureden.
SPIEGEL: Um die politische Kultur, genauer: um die Kultur der
Volksparteien ist es weniger gut bestellt. Austrittswelle,
Vergreisung, Wahlenthaltung sind die Stichwörter.
Glotz: Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir die
Großorganisationen - katholische Kirche, SPD, aber auch IG Metall des
Jahres 1970 - nicht wiederkriegen. Ich habe jetzt 40 Jahre lang
irgendwo an Kathedern gestanden und bin mit Studenten umgegangen. Sie
kriegen die Studenten in St. Gallen weder als Mitglieder der SPD noch
der CDU oder der FDP. Diese klassische feste Mitgliedschaft mit
Zahlabend in der Gaststätte "Zur grünen Linde", das ist vorbei.
SPIEGEL: Die Alternative ist allerdings nicht in Sicht.
Glotz: Wir brauchen Quereinstiege. Was glauben Sie, wie hoch
meine Telefonrechnungen waren, als ich erst Günter Verheugen und
später Otto Schily in der SPD durchsetzte. Da waren alle dagegen. Ich
werde nie vergessen, wie bei Verheugen die Frauen auf mich zuliefen,
weil ich ihnen irgendeinen Frauenlistenplatz wegnahm. Genauso bei
Schily in Bayern. Und heute sind das zwei der stärksten Politiker,
die die SPD überhaupt hat.
Ich habe noch Zeiten erlebt, wo ein Vorstandsvorsitzender zu Herbert
Wehner ging und feuchte Hände hatte, weil er zu Herbert Wehner ging.
Heute sehe ich nur Politiker, die feuchte Hände bekommen, wenn sie zu
Heinrich von Pierer gehen oder zu Jürgen Schrempp.
Grass: Wir können nicht einklagen, dass wir bis in die
achtziger Jahre hinein Politiker hatten, die gebrochene Existenzen
waren und dadurch Charakter gewonnen haben. Auch wenn man feuchte
Hände hatte auf dem Weg zu Herbert Wehner, wusste man, man kam zu
jemandem, der ein Vulkan war. Seine Vergangenheit hat ihn geformt.
Wir können diese junge Generation nicht dafür anklagen, dass sie
keinen Krieg durchgemacht hat. Sie ist von der Friedenszeit geformt
worden und so geworden, wie sie ist - ein bisschen langweilig und
austauschbar. Damit müssen wir wirtschaften.
SPIEGEL: Jetzt haben wir die Kritik des Volkes an seinen
Politikern diskutiert. Es geht aber auch umgekehrt. Schröder findet,
die Deutschen seien zu unbeweglich. Sind wir ein erstarrtes Volk?
Grass: Wenn man ein paar Wochen ins Ausland fährt und
zurückkommt, hört man nur Gejammer. Die Einsicht ist mittlerweile
vage da: Ja, wir brauchen Reformen. Aber der zweite Satz ist: nicht
bei mir. Das führt natürlich zu einer Unbeweglichkeit. Das ist
gefährlich.
SPIEGEL: Wie kann man diese Beweglichkeit herstellen, Herr
Lüpertz?
Lüpertz: Von Ideologie will ich nicht mehr reden. Also sage
ich: Wir brauchen Werte. Da muss ich als Kunstschaffender immer
wieder auf die Kultur verweisen. Die hat eine große Arbeit geleistet
und hat große Arbeit zu leisten. Das heißt also, dass Ausbildung und
Schule nicht nur ein Überlebenskampf sind, sondern dass da auch Werte
im Ideellen, im Freien, im Unsinnigen, im Unmöglichen, also nicht im
Kommerziellen vermittelt werden.
Freizeit ist eine reine Betäubungsangelegenheit. Unter meinen
Studenten ist kaum einer, der noch liest, wenn sie bei mir anfangen.
Sie zehren auf verheerende Weise von Fun, von Lustigsein. Das hat
eine seltsame Hohlheit. Das ist etwas, was ich der Politik nicht
anlasten kann. Das muss ich dem Volk anlasten.
Glotz: Da ist dann aber auch eine Schwäche zum Beispiel der
Sozialdemokratie. Wir können nicht die Gegenkultur, die die
Sozialdemokratie im 19. und im frühen 20. Jahrhundert war,
wiederholen. Es reicht nicht, "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" zu
singen. Das ist vorbei. Wir müssen andere Angebote machen.
SPIEGEL: Wir sprachen ja eben über Sinnstiftung. Nun hatte
Schröder eigentlich eine
große Chance, nämlich in der Rede zur Agenda 2010
eine solche Sinnstiftung zu liefern. Er hat es nicht gemacht. Er
sagt, Pathos könne er nicht. Glauben Sie, dass er da eine Chance
vergeben hat?
Grass: Ich kann bei Schröder nicht einklagen, was er auch
dankenswerterweise nicht hat. Er hat für einen Politiker relativ
wenig falsche Töne. Er spricht ein klares, schmuckloses Deutsch,
bringt die Dinge auf den Punkt. Mehr ist bei ihm in der Sache nicht
drin.
Glotz: Das Problem hatten wir schon bei Helmut Schmidt, der
auch nicht das Charisma Willy Brandts hatte und trotzdem ein sehr
guter Politiker war.
SPIEGEL: Liegt Schröders größeres Problem vielleicht darin,
dass er das, was er in der Agenda 2010 vorgetragen hat, ein bisschen
sehr spät entdeckt hat? Dass im Verlauf der rot-grünen Koalition
immer unterschiedliche Dinge gesagt worden sind? Einmal machen sie
eine Steuerreform; dann schmeißen sie sie in die Flut. Dann ziehen
sie sie wieder vor und wundern sich, dass sie sie nicht durch den
Bundesrat kriegen. Fehlt es an Geradlinigkeit?
Glotz: Dem kann ich nicht widersprechen. Die Agenda 2010 hätte
mindestens 1999 oder 2000 stattfinden können. Sie hat aber erst nach
der Bundestagswahl 2002 und auch da erst nach einem Jahr
stattgefunden. Das war zu spät.
SPIEGEL: Sie alle haben stramme Konservative wie Filbinger,
Carstens, Dregger und Strauß erlebt und bekämpft. Taugt die Union von
heute noch zu einem Feindbild?
Grass: Da hat ein Generationswechsel stattgefunden. Dass die
Politiker in diesen Positionen austauschbarer sind als in den
zurückliegenden Jahrzehnten, trifft nicht nur auf die SPD zu, sondern
auch auf die CDU und die FDP. In allen Parteien gab es auf Grund der
Generationserfahrung ausgeprägtere Persönlichkeiten, bis zur
Unerträglichkeit - ob Wehner oder Strauß. Das waren ja Brocken, an
denen man in der Tat auch scheitern konnte innerhalb der eigenen
Partei. Das waren Bollwerke. Die gibt es heute nicht mehr, aber die
soll man sich vielleicht auch gar nicht wünschen.
SPIEGEL: Frau Merkel hat durchaus eine bewegte Biografie
vorzuweisen, von der Pfarrerstochter und Physikerin zur
Oppositionsführerin in der West-CDU. Imponiert Ihnen das?
Grass: Nein, absolut nicht. Frau Merkel beherrscht die
parteiinterne Intrige. Sie kann Leute gegeneinander ausspielen, sie
kann ihre Position halten. Notfalls ist sie auch schamlos genug, wie
eine Petzliese die eigene Regierung in Washington anzuschwärzen. Als
Bush noch gute Umfragewerte hatte, hat sie sich nicht entblödet, den
Bundeskanzler im Weißen Haus nicht nur zu kritisieren, sondern sich
als diejenige darzustellen, die die wahre Freundin Amerikas ist. Das
ist für mich keine Position.
SPIEGEL: Und die Sozialreformen, die sie letztlich wie
Schröder machen will, nur ein bisschen zügiger, radikaler,
grundsätzlicher? Schätzen Sie die Sozialreformerin Merkel?
Grass: Ich sehe sie nicht. Wenn es ans Eingemachte geht, zum
Beispiel bei den Subventionen, ist sofort die Sperre im Bundesrat
organisiert.
Glotz: Merkel verhält sich jetzt in der Tat so, wie wir uns
verhalten haben, als Kohl noch regierte: Der Bundesrat wird als
Oppositionsinstrument benutzt.
SPIEGEL: Herr Lüpertz, fällt von Ihnen ein wohlmeinenderer
Blick auf Angela Merkel?
Lüpertz: Ich glaube, dass sie niemals viel erreichen kann,
denn sie lebt von der Opposition. Wenn sie denn tatsächlich aus
irgendeinem Grund Kanzlerin werden sollte, was ich nicht glauben
kann, dann wird sie sehr schnell scheitern. Ihre eigene Partei wird
sie fallen lassen.
Glotz: Herr Lüpertz, Sie müssen wir zum
Unterbezirksvorsitzenden in der SPD machen. Sie sind noch so
optimistisch. Solche Optimisten brauchen wir.
Lüpertz: Ich bin fest davon überzeugt.
Grass: Ich glaube auch, dass wir die Wahl gewinnen können.
SPIEGEL: Für Willy Brandt sind Sie in den Wahlkampf gezogen,
dokumentiert im "Tagebuch einer Schnecke". Nun heißt es allerorten,
Schröder habe ein Vermittlungsproblem mit der Agenda 2010. Könnten
Sie sich vorstellen, dem Kanzler bei der Vermittlung dieser Agenda zu
helfen?
Glotz: Ich bin dabei, wo immer ich gebraucht werde.
Grass: Ich bin jetzt 76. Wenn ich in zwei Jahren noch bei
Puste bin, was ich hoffe, werde ich wieder in die Bütt steigen, und
zwar für Rot-Grün.
SPIEGEL: Und Sie, Herr Lüpertz?
Lüpertz: Ich habe versucht, mich als Künstler immer aus der
Politik so weit herauszuhalten, dass ich sie als Beobachter sehe.
Solange sie demokratisch ist, habe ich nichts dagegen. Sollte das
Land in eine Richtung abrutschen, die mir nicht passt, würde ich zum
Kohlhaas werden wollen.
Glotz: Der Kohlhaas endet aber böse.
Lüpertz: Das Leben eines Künstlers endet immer tragisch.
SPIEGEL: Herr Grass, Herr Glotz, Herr Lüpertz, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
|
|
|